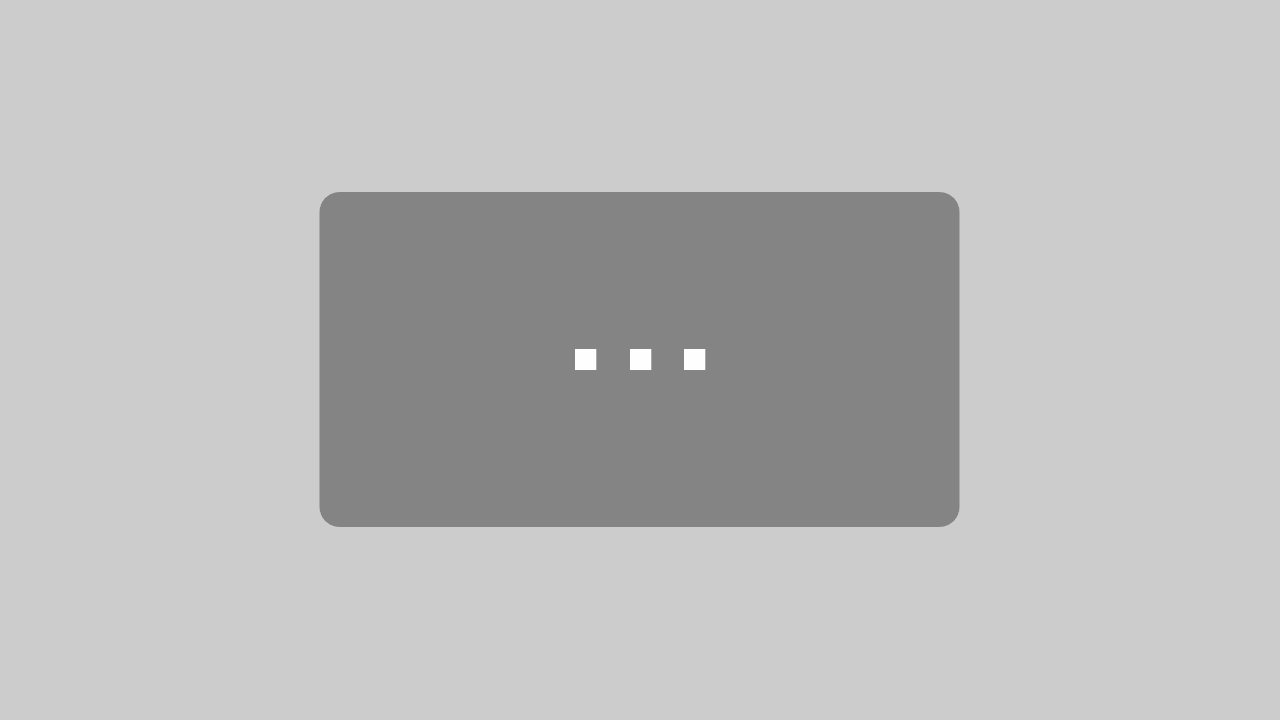Als Schiller im Frühjahr 1785 auf Einladung eines seiner Bewunderer, Christian Gottfried Körner (1756-1831) später Herausgeber der ersten Schiller-Gesamtausgabe, nach Leipzig reist, flieht er vor allem vor seinen Schulden. Weil sein 1783 geschlossener Vertrag als Theaterdichter am Mannheimer Theater ausläuft und Schiller bis über beide Ohren in Schulden steckt, sieht er keine andere Möglichkeit als die Flucht. Seine Lage ist derart schwierig, dass er fast im Schuldturm gelandet wäre. In Leipzig wird Schiller von Körner und seinem Freundeskreis herzlich aufgenommen. Er wohnt zeitweise auch in Körners Haus in Leipzig, aber vor allem ab September 1785 in dessen Weinberghaus in Loschwitz bei Dresden. Dank Körner kann er in Leipzig und Dresden frei von materiellen Sorgen u.a. an seinem Drama Don Carlos weiterarbeiten und außerdem viele wichtige Beziehungen knüpfen. Als Ausdruck von Schillers tiefempfundener Dankbarkeit zu seinem Freund und Mäzen Körner, entstand im Sommer 1785, wohl noch in Leipzig, die berühmte Ode an die Freude. In diesem Gedicht, obwohl ein ganz spontaner Ausdruck der Dankbarkeit, das auch Züge eines Trinklieds nicht vermissen lässt („Brüder, fliegt von euren Sitzen, Wenn der volle Römer kreist, Laßt den Schaum zum Himmel sprützen: Dieses Glas dem guten Geist“), formuliert Schiller ebenjene Gedanken, die vier Jahre später zur französischen Revolution führen, gleich in der ersten Strophe:
Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken
Himmlische, dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
Was der Mode Schwert geteilt;
Bettler werden Fürstenbrüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.
Der geneigte Leser, die geneigte Leserin wird sich an dieser Stelle denken, „Moment, das ist nicht die Ode an die Freude, die ich kenne!“ Und das stimmt, denn die erste, 1786 gedruckte Fassung unterscheidet sich in entscheidenden Details von der von Schiller 1803 revidierten Fassung, die heute bekannt ist. Es scheint fast so, als habe sich Schiller für seinen Enthusiasmus des Jahres 1785 nachträglich geschämt, denn aus den Versen
Was der Mode Schwert geteilt;
Bettler werden Fürstenbrüder
wird später:
Was die Mode streng getheilt,
Alle Menschen werden Brüder,
Und die letzte Strophe der ersten Fassung
Rettung von Tyrannenketten,
Großmut auch dem Bösewicht,
Hoffnung auf den Sterbebetten,
Gnade auf dem Hochgericht!
Auch die Toten sollen leben!
Brüder trinkt und stimmet ein,
Allen Sündern soll vergeben,
Und die Hölle nicht mehr sein.
streicht Schiller sogar komplett.
In einem Brief an Körner (Oktober 1800), 15 Jahre nach der Entstehung, schreibt Schiller sogar, das Gedicht sei schlecht:
„Die [Ode an die] Freude hingegen ist nach meinem jetzigen Gefühl durchaus fehlerhaft und ob sie sich gleich durch ein gewißes Feuer der Empfindung empfiehlt, so ist sie doch ein schlechtes Gedicht und bezeichnet eine Stufe der Bildung, die ich durchaus hinter mir lassen mußte um etwas ordentliches hervorzubringen. Weil sie aber einem fehlerhaften Geschmack der Zeit entgegenkam, so hat sie die Ehre erhalten, gewissermaaßen ein Volksgedicht zu werden. Deine Neigung zu diesem Gedicht mag sich auf die Epoche seiner Entstehung gründen; aber diese giebt ihm auch den einzigen Werth, den es hat, und auch nur für uns und nicht für die Welt noch für die Dichtkunst.“
In seinem eigenhändigen Werkverzeichnis hat Schiller das Gedicht lange absichtlich ausgelassen, obwohl die Ode an die Freude nicht nur heute, sondern schon zu Schillers Zeit ausgesprochen beliebt war, etwa als Studentenlied, und zahlreiche Vertonungen vorliegen. Heute ist fast ausschließlich die 1824 von Ludwig van Beethoven unternommene Vertonung bekannt, obwohl zum Beispiel Franz Schubert die Ode an die Freude bereits 1815 in der Besetzung für Singstimme und Klavier vertont hat:
Beethoven hat bereits 1793 und später immer wieder erwogen Schillers Gedicht in Töne zu setzen. 1812 schreibt er in eines seiner Skizzenbücher:
„Freude schöner Götterfunken – Ouvertüre ausarbeiten […] abgerissene Sätze wie Fürsten sind Bettler u.s.w. – nicht das Ganze“
Nach seiner achten Sinfonie wollte Beethoven eigentlich keine Sinfonie mehr schreiben. 1817 erreichte ihn jedoch ein Auftrag der Londoner Philharmonic Society, die Beethoven um die Komposition zweier Sinfonien und deren Uraufführung in London bat. Aber es dauert bis 1822 bis Beethoven, der mit den drei letzten Klaviersonaten und der Missa solemnis beschäftigt ist, dazu kommt im Kurort Baden bei Wien an den ersten drei Sätzen der 9. Sinfonie zu arbeiten, die er 1823 vollendet. Gegenüber der für uns heute wie selbstverständlich scheinenden Idee, den vierten Satz mit einem Chorfinale (Freude schöner Götterfunken) enden zu lassen, ist Beethoven während der Komposition in starke Zweifel geraten. Immer wieder denkt er über ein instrumentales Finale nach, sogar noch nach der Uraufführung am 7. Mai 1824. Dieses Chorfinale ist seit der Uraufführung bis heute ein großer Streitpunkt. Für den Komponisten Louis Spohr (1784–1859), ein Zeitgenosse Beethovens, ist es „monströs und geschmacklos und in seiner Auffassung der Schillerschen Ode […] trivial“. Der Dichter Ludwig Rellstab (1799–1860), der als Konzertberichterstatter über die Erstaufführung Ende November 1827 in Berlin schreibt, lobt besonders den zweiten Satz, das Scherzo, mit Abstrichen auch den ersten und dritten Satz, der vierte Satz hingegen sei problematisch:
„[V]om letzten Satz müsse man sagen, daß er an barocker Seltsamkeit alles überbietet, woran uns unser, an solchen Leistungen nicht arme Zeit, bisher zu gewöhnen gesucht hat. Es mischt sich aus dem Styl der ernsteren Kirchenmusik und der Opera buffa, und die Instrumentation trägt noch stets dazu bei, das Auffallende noch auffallender, das Unbegreifliche noch unbegreiflicher zu machen.“
Rellstab, der äußerst bewundernd über die dritte und fünfte Sinfonie geschrieben hat, formuliert hier das Grundproblem des vierten Satzes, denn Beethoven sprengt einerseits die Form der Sinfonie und „spricht“ auf der anderen Seite die Botschaft, die in der absoluten Instrumentalmusik steckt, die sich aber sonst unausgesprochen mitteilt (so wie etwa in der fünften Sinfonie das Motiv „per aspera ad astra“) ganz konkret aus. Beethoven versucht also im vierten Satz das Unsagbare auszusprechen. Zumindest die Utopie der revolutionären Gedanken Schillers, durch das Pathos des Chrofinales noch verstärkt, war 1824, zur Zeit der Restauration und des Metternichschen Überwachungsstaates noch viel größer als zur Zeit Schillers.
Christoph Goldstein
Fotos:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven#/media/Datei:Beethoven.jpg