Heimatsound oder: Was habe ich nicht verstanden?

Während der frühmorgendlichen „radioWelt“, dem aktuellen Magazin auf Bayern2, kündigte der Moderator erst kürzlich einen Musiktitel an, und zwar mit folgenden Worten: „Und jetzt kommt Heimatsound aus München – Jamaram mit Diamond Girl“. Dann folgte ein Reggae mit englischem Text. Stilistik und Sound ließen nichts erkennen, was man auch nur annähernd als Heimatsound deklarieren bzw. mit Heimat in Verbindung bringen könnte. Dies war erstaunlich, aber es war nicht das erste Mal, dass man im Bayerischen Rundfunk unter der Bezeichnung Heimatsound einen Musiktitel hören konnte, der keinerlei Assoziation zu Bayern ermöglichte.
Um an dieser Stelle keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Es geht hier nicht darum, die achtköpfige Band Jamaram zu kritisieren. Die Musiker sollen selbstverständlich spielen, was ihnen gefällt. Außerdem lieferten sie mit ihrem Song einen eigenen Titel ab, der gut interpretiert und ebenso gut eingespielt war. Sie erwiesen sich als Profis, ihre Musik ist ansprechend; sie trifft den populären Musikgeschmack. Ebenso wenig soll hier ein Plädoyer auf die vermeintlich „gute, echte“ und unveränderbare Volksmusik gehalten, geschweige denn die Käseglocke über einen Musik-Konservatismus gestülpt werden, der von vorneherein auf tönernen Füßen stand. Im Gegenteil: Die Bezirksheimatpflege, insbesondere in Niederbayern, gehört wohl zu jenen Institutionen, die der Neuen Volksmusik und dem Tradimix, aus dem der Heimatsound überhaupt erst hervorgehen konnte, schon in den frühen 1990er-Jahren fachlich den Weg geebnet haben. Das vollzog sich damals übrigens nicht ohne erhebliche Widerstände der Traditionalisten.
Aber wer heute auch immer die Deutungshoheit über den Begriff „Heimatsound“ beansprucht: Was ist der Grund, dass man englischsprachige Popmusik wie den genannten Titel „Diamond Girl“ als Heimatsound aus Bayern deklariert? Melodisch, rhythmisch, harmonisch und auch instrumental erinnert nichts an Heimat – zumindest nicht an eine bayerische oder alpenländische. Es kommt im Text auch kein einziges Wort in deutscher Sprache vor, von irgendeinem Regional- oder Ortsdialekt gar nicht zu reden.
So stellt sich generell die Frage: Was zeichnet den Heimatsound aus? Genügt es etwa schon, wenn die Musiker aus Bayern stammen oder in Bayern wohnen? Oder gibt es irgendwelche anderen Kriterien? Und wenn, wer legt sie fest? Oder ist sowieso alles „wurscht“? Also: Was habe ich u. a. als Musikwissenschaftler, der Musik zu analysieren gelernt hat, nicht verstanden? Vielleicht kann mich jemand fachlich fundiert aufklären.
MS
Heimat – erst verkannt, dann wiederentdeckt

Heuer sind es 40 Jahre: Im Jahr 1979 lud die Deutsche Gesellschaft für Volkskunde zum Kongress „Heimat und Identität. Probleme regionaler Kultur“ nach Kiel ein. Namhafte Volkskunde-Lehrstuhlinhaber deutscher Universitäten hatten „Heimat“ zum kulturwissenschaftlichen Betrachtungsgegenstand erhoben. Damit begann die historische Aufarbeitung des Heimatbegriffs, allerdings begrenzt auf eine überschaubare Anzahl von Akademikern aus so genannten Orchideenfächern.
Ansonsten interessierten sich damals weder die Gesellschaft noch die Politik für dieses politische Thema. Zu unwichtig schien dies in wirtschaftlich prosperierenden Zeiten. Zeitlich zu nah lag noch der nationalsozialistische Heimat-Missbrauch. Posttraumatisiert ließ sich allenfalls von links pauschal und bequem in die rechte Ecke stellen, was mit Heimat in Verbindung zu bringen war. Als ewige Gestrige scherte man Trachtenträger und Heimatpfleger lange Zeit über einen Kamm – nicht nur in den Medien. Kaum jemand wollte bemerken, dass sich seit den 1980ern eine neue Kulturhistoriker-Generation in der Heimatpflege etablierte, die – anstatt weltvergessen Heimatlieder vor sich hinzuträllern und Trachtenknöpfe abzuzählen – zur kritischen Analyse des Vergangenen und Gegenwärtigen fähig war. Doch dies passte nicht ins Klischee: Die Verweser überlebten Vätererbes empfanden diesen Aufbruch als Nestbeschmutzung, während Medien weiterhin bevorzugt das Bild von den Heimat-Exoten aufrecht hielten. Thema und Interpretation zeigen, wie Scheuklappen den Blick verengten, und zwar von jeder Seite, und vielleicht nicht nur damals. Denn Heimat ist mehr als ein wenig Volkstumspflege zwischen Kitsch, Kultur und Politik.
Offensichtlich sind es Krisen, die das Thema Heimat auf den Plan rufen: Im 19. Jahrhundert waren es die Industrielle Revolution und die gesellschaftlichen Umwälzungen. Gegenwärtig sind es die rasanten Umbrüche, die mit der Globalisierung, Urbanisierung, Migration und Digitalisierung einherschreiten. Wo solche Ängste im Spiel sind, lässt die Sehnsucht nach Sicherheit, Überschaubarkeit und Kontinuität nicht lange auf sich warten. Immer dann wird Heimat, die man gern im Ländlichen zu finden glaubt, zum Kompensations(w)ort, sei es nun fiktiv oder real.
Fast 40 Jahre nach dem ersten wissenschaftlichen Heimat-Kongress nimmt man sich jetzt – nicht mehr zu früh – von staatlicher Seite des Themas an. Man hat Heimatministerien gegründet, zuerst auf Landesebene in Bayern, zuletzt auf Bundesebene. Von der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist die Rede. Das signalisiert Dörfern, Kleinstädten und Landgemeinden staatliche Zuwendung „von oben“. Abzuwarten bleibt, was für das Land dabei wirklich herausspringt. Mit ein paar Heimatfesten mehr wird es nicht getan sein.
MS
(Foto: Klaus Leidorf)
Das Karteln – der Bayern Lust

Karteln ist ein lustvoller Zeitvertreib. Schafkopf und Watten sind hierzulande zweifellos die bekanntesten und beliebtesten Spiele. Viele Spielgruppen treffen sich über Jahre hinweg in fester Konstellation. Gespielt wird dabei meist zu viert. Spielvarianten mit einer abweichenden Zahl an Spielern sind aber möglich.
Im Unterschied zum Watten, das nur Zweierteams kennt, gibt es beim Schafkopf verschiedene Formen des Einzelspiels (Solo, Wenz, Wenz-Tout usw.). Dann misst sich ein Spieler mit allen anderen. Beim sogenannten Ramsch spielen wiederum alle gegeneinander. Zudem klärt sich beim variantenreichen Schafkopf erst zu Beginn – nach dem „Ruf“ des Spielmachers –, wer mit wem zusammenspielt. Die Teams beim Watten stehen dagegen von Anfang an fest.
Die Unterschiede zwischen den Spielen zeigen sich insbesondere auch bei der Kommunikation während des Spielverlaufs. Beim Schafkopfen ist es sträflich verboten, durch eine Andeutung eine Information zu geben oder an eine des Mitspielers zu gelangen. Fliegt ein solcher Betrugsversuch auf, wird sofort „zamgworfn“ und der Ertappte muss die Runde zahlen. Ganz anders sieht es beim Watten aus: Das Andeuten macht hier erst den eigentlichen Witz des Spiels aus. Vom Spitzen der Lippen, über blinzeln bis hin zum Zucken mit der Schulter gibt es eine Vielzahl von Geheimzeichen. Diese nutzt man, um sich mit dem Partner auszutauschen, möglichst ohne dass das gegnerische Team mitbekommt, was „odeit“ wird. Um die Beteiligten in die Irre zu führen, kann ein Spieler auch Karten andeuten, die er gar nicht hat. Dann blufft er wie beim Poker oder dem französischen Truc. Je nachdem wie geschickt odeit wird, wissen beide Teams mehr oder weniger über das Blatt der Gegner Bescheid. Wer sich dabei allerdings ungeschickt anstellt, verunsichert auch seinen Spielpartner. Um es mit den Worten des Oberpfälzer Schriftstellers Eugen Oker zu sagen: Watten ist „eine deftige, hinterfotzige Pantomime, eine Komödie im Sitzen mit tragischen Akzenten“. Erlernt werden kann es ihm zufolge nicht; einzig das „bayrisch Herz“ befähigt zum Spielen. In jedem Fall sind beide Spiele unbestreitbar tief in der bayerischen Kultur verwurzelt. Außerdem bieten sie denjenigen Freizeitvergnügen, die Freude an Logik und Konzentration haben oder das Vortäuschen und Interpretieren zu nutzen wissen.
Viele Jahrhunderte hindurch wurde das Kartenspiel von der Kirche als „Gebetbuch des Teufels“ geschmäht. Heutzutage bewertet man ganz anders. Erst vor wenigen Wochen hat sich der Verband der Lehrkräfte an Gymnasien und der Philologenverband sogar für das Schafkopfen im Unterricht ausgesprochen, eben weil es auf Logik aufbaut und konzentrationsfördernd ist. Watten musste dagegen um seine Existenzberechtigung fürchten. Da nicht alle Karten zu Beginn ausgegeben werden wie beim Schafkopf, wurde das Watten im letzten Jahr zum illegalen Glücksspiel erklärt. Diesen Bann hat der bayerische Innenminister aufgehoben, in der Auffassung, dass hier überzogen wurde, und Karteln bewahrenswertes Kulturgut darstellt.
LS
Welche Knödel?

In Zeiten, in denen ein Bundespräsident die Bevölkerung seines Landes darum ersuchen muss, miteinander zu reden und praktisch ein schier unübersichtlicher Haufen von Gesprächsinhalten scheinbar nur noch dazu dient, Gräben zu vertiefen, soll hier einmal daran erinnert werden, dass es Themen gibt, die genüsslich ausdebattiert werden können, ohne Freundschaften auf immer und ewig auseinanderbrechen zu lassen. Motto: Lernt streiten im Kleinen. Und da bieten sich beispielsweise Praktiken der Kulinarik an, die auch innerhalb meines Hauses gelegentlich für schöne, hausgemachte Debatten zum schönen, hausgemachten Schweinebraten dienen: Semmel- oder Kartoffelknödel?
Über die grammatikalisch korrekte Darreichungsform der Semmelknödel (bzw. Semmelnknödeln) hat sich schon Karl Valentin, der große Vordenker alles wirklich Wesentlichen, so seine Hirnwindungen durchgewrungen: „Semmel ist die Einzahl, das mußt Ihnen merken, und Semmeln ist die Mehrzahl, das sind also mehrere einzelne zusammen.“ Und bis zur Hälfte ernstzunehmende Ethnologen haben behauptet, dass Bayern sowieso liebend gerne runde Dinge essen (Knödel, Pflanzerl, Rollbraten), weil sie im Kern ihrer Existenz danach trachten, selbst so rund wie möglich zu werden: Sie erkennen solcherart das G’wamperte in ihrem Essen als Idealbild schon mit.
Was jedoch die eigentliche Knödelfrage doch eher nur am Rande streift. Harmoniebedürftige Wirte servieren in ihren heiligen Speisehallen einfach zum Braten je einen Kartoffel- und einen Semmelknödel, und es gibt Rückzugsgebiete in Niederbayern, wo der Ritschi- oder Ranschknödel zubereitet wird, der aus beiden Ingredienzien besteht. Aber das sind Hilfskonstruktionen jener, die eine eindeutige Position meiden. Rein wort- und herkunftsmäßig hat die Semmel natürlich die älteren Rechte, weil sie sich schon aus dem Lateinischen ableitet, wo die Leute „simila“ zum Weizenmehl sagten – und aus solchem ist die Semmel ja gemacht.
Während die Kartoffeln wie auch Mais und Tomaten Produkte Amerikas sind, die erst nach der Zweit-, Dritt- oder Viertentdeckung des Kontinents auf den europäischen Markt gerieten, zusammen mit dem Tabak übrigens, der Rache der Indianer am Weißen Mann. Privatforschungen haben ergeben, dass im Großen und Ganzen der Kartoffelknödel eher die Oberpfalz prägt, während der Semmelknödel mehr in Rest Altbaierns verbreitet ist, was insofern naheläge, als dort der Weizen deutlich besser wächst als in der vom Kartoffelanbau geprägten „Steinpfalz“. Motto. Wir machen Knödel aus allem, was da so herumliegt. Aber stimmt das auch wirklich so?
Die innerhäusliche Debatte um die korrekte Beilage zum Schweinsbraten wurde schließlich durch einen Gastwunsch gelöst: Es gab Spätzle.
Rettet die Bienen – bei Artenvielfalt geht´s um mehr

Derzeit erhitzt das Volksbegehren „Artenvielfalt – Rettet die Bienen“ die Gemüter im Land. Während der Bayerische Bauernverband (BBV) dagegen protestiert, scheinen die Initiatoren einen Nerv getroffen zu haben. Denn das rasante Verschwinden von Insekten, Vögeln und bunten Wiesenkräutern bemerkt jeder, der aufmerksam durch unsere Fluren läuft. Dabei ist es unbestritten, dass dafür nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch alle Flächenverbraucher wie Industrie und Gewerbe, Siedlungs- und Straßenbau, kurz: wir alle mit unserem ungebremsten Wachstumsdenken verantwortlich sind. Denn wer seine im Internet bestellten Waren unbedingt „sofort“ haben will, nimmt mehr Schwerlastverkehr genauso billigend in Kauf wie derjenige, der möglichst täglich ein ganz billiges Stück Sonderangebots-Fleisch auf dem Teller sehen will.
Das große Insektensterben ist seit der sogenannten „Krefelder Studie“ aus dem Jahr 2017, die einen Rückgang der einst üppigen Welt der Schmetterlinge, Bienen und Käfer um 75 Prozent dokumentierte, in aller Munde. Fachleute wie Landschaftsplaner, engagierte Naturschützer oder Journalisten – wie Dieter Wieland und der jüngst verstorbene Horst Stern –, oder Künstler wie Biermösl Blosn weisen schon seit den großen Flurbereinigungen der 70er Jahre darauf hin, dass der fortlaufende Verlust von Ackerrainen, Hecken, Wiesenstreifen entlang der Kleingewässer und das Beseitigen von Kleinstrukturen verheerende Folgen haben können. Zu einem Rückgang der Artenvielfalt, Bodenfruchtbarkeit und Schönheit unserer Kulturlandschaft führen auch Monokulturen, Pestizideinsatz und das Bestreben, auch den letzten Quadratmeter zur Steigerung der Erträge zu nutzen. Verschmutzung des Trink- und Grundwassers, Bodenerosion durch Wasser und Wind sind einige der Auswirkungen.
Jetzt also scheint das Fass überzulaufen. Rund zehn Prozent der bayerischen Bevölkerung sagte bereits „Stopp! Es reicht!“ und hat für das Volksbegehren „Artenvielfalt“ unterschrieben.
Doch das allein wird nicht genügen, wenn nicht auch ein Wandel im Bewusstsein und Verhalten eintritt: Wenn wir uns nicht fleischärmer und qualitätsbewusster ernähren, wenn wir nicht die wenigen Prozent Biobauern stärker unterstützen durch unser Einkaufs- und Konsumverhalten, wenn wir uns nicht insgesamt auf Weniger und einen gesünderen Lebensstil umstellen – für unsere Heimat. Wenn wir unsere Gärten statt mit Kies, Schotter und insektenfeindlichen Immergrünen nicht wieder mit vielfältiger, bunter Pflanzenwelt anlegen, wird das große Sterben weitergehen. Dass der BBV jetzt Patenschaften anbietet, bei denen Privatpersonen 50 Euro spenden, damit 100 Quadratmeter Ackerland in eine Mini-Blumenwiese umgewandelt werden, wird von Befürwortern des Volksbegehrens als Alibivorschlag und Ablasshandel gesehen, der viel zu kurz greife. Die Kritik lautet: Der Vorschlag gehe das Problem nicht radikal genug an der Wurzel an.
Es braucht manchmal Jahrhunderte und das geduldige Bohren von weitaus dickeren Brettern, um wieder einen lebendigen fruchtbaren und belebten Oberboden entstehen zu lassen. Und eine bereits verschwundene Tier- und Pflanzenart kehrt sehr, sehr selten wieder zurück.
Man darf gespannt sind, wie die bayerische Staatsregierung, die nach der letzten Landtagswahl eine „grünere“ Landespolitik versprochen hat, reagieren wird. Ein runder Tisch mit Umweltverbänden und Vertretern der Landwirtschaft allein wird nicht helfen.
HW
(Foto: Johannes Selmansberger )
Fridays for Future – und was kommt danach?

22.000 Jugendliche in 16 Städten waren es jüngst in der Schweiz, 30.000 Schüler in 50 deutschen Städten, 15.000 junge Menschen in Australien. Die freitäglichen Schülerstreiks für Klimaschutz haben sich seit Dezember zu einer globalen Protestbewegung entwickelt. Galionsfigur dieses Protests ist die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg, die seit Monaten jeden Freitag dem Schulunterricht fernbleibt und vor dem Parlament in Stockholm demonstriert. Ihren internationalen Ruf als Umweltaktivistin erlangte sie endgültig durch ihre Auftritte bei der UN-Klimakonferenz in Katowice 2018 und beim Weltwirtschaftsforum in Davos 2019.
Am Freitag, den 25.Januar 2019 streikten auch Deggendorfer Schüler, Anfang Februar zudem Schüler in Passau. Nicht nur in Niederbayern gerieten die Schulleitungen durch diese Freitagsproteste in Erklärungsnot. Einerseits wollte niemand den Jugendlichen banales „Schulschwänzen“ unterstellen, andrerseits kann kollektives Fernbleiben vom Unterricht und Missachtung der Schulpflicht nicht geduldet werden. So wurden die Aktionen unter der Voraussetzung ihrer Einmaligkeit kurzerhand zu „Veranstaltungen der politischen Bildung“ erklärt und im Nachgang gebilligt. Schließlich sei es positiv, wenn sich Schüler politisch engagieren, ließ der Präsident des Deutschen Lehrerverbands und Schuldirektor des Robert-Koch-Gymnasiums in Deggendorf, Heinz-Peter Meidinger, wissen. Wer könnte dem widersprechen?
Die Demonstrationen sollen weitergehen, in Niederbayern und anderswo, aber außerhalb der Schulzeit. Damit wäre der latente Vorwurf des Schulschwänzens entkräftet. Abzuwarten bleibt, wie lange die Jugendlichen ihr Engagement durchhalten. Ob sich dieses als kurzfristiger Hype entpuppt oder ein wirklich ernsthaftes Anliegen dahintersteckt? Dann nämlich sollte den bisher pauschalen Vorwürfen den Mächtigen und Alten gegenüber, die nach dem Vorbild Thunbergs bei Protestaktionen formuliert werden, auch Selbstreflexion folgen. Die Frage würde lauten: Was außer Protest kann ich selbst vor Ort konkret zum Klimaschutz beitragen? Möglichkeiten gibt es genug: Bewusst eine Stunde am Tag Smartphone und iPad abschalten, nicht permanent online sein, nicht in den sozialen Medien alberne Fotos empfangen und posten, würde die Großrechner in den Rechenzentren dieser Welt enorm entlasten. Dies wäre ein erster Schritt effektiver Stromeinsparung und wirksamen Klimaschutzes. Zum Geburtstag auf das iPhone der neuesten Generation verzichten und ein weiteres Jahr das alte benutzen, hilft nicht nur wertvolle endliche Rohstoffe sparen. Keine coolen Klamotten günstig online bestellen, die irgendwo auf der Welt von Kindern und Jugendlichen unter schlechtesten Arbeitsbedingungen für einen Hungerlohn hergestellt werden müssen. Die Welt auf diese Weise ein Stück besser machen, das wäre mal so richtig cool. Eine vitalstoffreiche Ernährung gelingt auch ohne Kiwis aus Neuseeland, Avocados aus Brasilien und Mangos aus den Tropen. Ebenso gesund ist heimisches Obst und Gemüse der Saison, das nicht Tausende von Seemeilen von riesigen, mit Schweröl betriebenen Containerschiffen über die Weltmeere geschippert wird. Und um den Abfall wenigstens zu verringern, kann man den Kaffee aus der guten alten Tasse trinken. Denn der Coffee- to-go-Becher mit Kunststoffdeckel ist ein No-Go. Weniger Müll, mehr Umweltschutz, besseres Gewissen. Kapiert?
Also, protestiert weiter, aber handelt danach!
MS
(Foto: Roland Binder)
Moderne Zeiten und alte Bräuch‘: Schlenkeltage

Am 5. Februar 1936 wurde der Spielfilm „Moderne Zeiten“ (orig. „Modern Times“) in den USA uraufgeführt – ein zeitloser Klassiker an der Schnittstelle vom Stumm- zum Tonfilm. Im Fokus: die industrialisierte Arbeitswelt und die Massenarbeitslosigkeit infolge der Weltwirtschaftskrise. Gezeigt werden geistig und körperlich ausgelaugte Fabrikarbeiter. Sie drohen vom Räderwerk der Maschinen und Laufbänder zerstampft zu werden. Allein menschliche Zuneigung bietet einen Ausweg aus Freiheitsverlust und Entmündigung. Charlie Chaplin hat damit den Befürchtungen angesichts der sich rapide verändernden Arbeitswelt im Film Ausdruck verliehen.
Nicht nur in den modernen Zeiten der Industrialisierung, sondern auch in der ländlich-bäuerlichen Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts standen einfache Arbeiter ohne eigenen Landbesitz auf den untersten Stufen der gesellschaftlichen Hierarchie. Als Dienstboten, Mägde und Knechte, „verdingte“ man sich an den Bauernadel. Der eigene Körper, die menschliche Arbeitskraft waren meist das einzig verfügbare Kapital. Ging der Verkauf dieser Arbeitskraft in den großstädtischen Industriebetrieben oft bis zur Selbstausbeutung – an Nachschub an billigen Arbeitern herrschte damals kein Mangel – so war die Dienstbotenwelt auf dem Land traditionell bis ins Detail geregelt: Ungeschriebene Gesetze über Vertragslaufzeiten und Entlohnung boten eine gewisse Sicherheit. Bei Nichtbeachtung drohten gesellschaftliche Sanktionen.
Ein bedeutender, von der ländlichen Arbeiterschaft herbeigesehnter Termin war – teils über seine Abschaffung als offizieller Feiertag im Jahr 1912 hinaus – der 2. Februar: Mariä Lichtmess. Der Lichtmesstag begrenzte das bäuerliche Wirtschaftsjahr: Dienstboten wechselten ihre Dienstherren, Knechte und Mägde erhielten ihren Jahreslohn. Ausbezahlt wurde nicht nur in Heller und Pfennig, sondern auch in materiellen Gütern wie (Arbeits-)Kleidung oder Stoffen für dieselbe. Neben dem sogenannten Dingpfennig, einer Art Anzahlung, die für ein weiteres Dienstjahr verpflichtete, sind weitere Geschenke brauchgeschichtlich bemerkenswert: Kerzen oder zum Teil aufwändig verzierte Wachsstöcke.
Liturgisch gesehen endet am 2. Februar, dem Fest der Darstellung des Herrn im Tempel, die vierzigtägige weihnachtliche Festzeit. Das Lukas-Evangelium erzählt die Geschichte vom greisen Simeon, der in Jesus den Messias, das „Licht zur Erleuchtung der Heiden“ erkennt. Zur Erinnerung an diese Metapher wird an Lichtmess der Jahresbedarf an Kerzen für die Kirchen geweiht. Die Gläubigen bringen auch Kerzen für den häuslichen Gebrauch zur Segnung, die bei Unwettern oder Todesfällen entzündet werden. So lag es auch nahe, Kerzen und Wachsstöcke innerhalb der Familie oder an langjährige geschätzte Dienstboten zu verschenken.
Weitaus beliebter als solch symbolische Gaben dürften den Knechten und Mägden die sogenannten Schlenkeltage gewesen sein: Die freien Tage um Lichtmess herum waren in einer Zeit ohne tariflich geregelten Urlaub eine ersehnte Unterbrechung des Arbeitsalltags. „Geschlenkelt“ werden konnte auf zahlreichen Lichtmessmärkten, die sich bis heute hie und da erhalten haben. Wohl viel zu früh endeten die Schlenkeltage, die an Mariä Lichtmess begonnen hatten, traditionell zumeist am Namensfest der heiligen Agatha, dem 5. Februar.
CLL
Schnee – des einen Freud, des anderen Leid?

Wie zum Sommer die Sonne gehört, gehört in unseren Breitengraden zum Winter der Schnee. Alle Jahre wieder stellen sich die großen Fragen: Wird es weiße Weihnachten geben, können die Kinder im Schnee toben, reicht der Schnee zum Skifahren in den Winter- und Faschingsferien? Fragen, die uns in Zeiten des Klimawandels und seiner Unwägbarkeiten begleiten.
Schnee ist weiß, hell, silbern und mit Kälte verbunden. Kinder bauen daraus Schneemänner, Jung und Alt freut sich auf den Wintersport. Zuhause knistert das Kaminfeuer, es wird heißer Tee getrunken, der in der Winterzeit gelegentlich mit einem Schuss Rum „verfeinert“ wird, oder der Erholung wegen eines der vielfältigen Wellnessprogramme wahrgenommen. Schnee ist und wird so zu einem Erlebnis, zur großen Sehnsucht für die Menschen. Es sind zugleich jene Bilder, die sich von Hotels und Tourismus gut bewerben lassen. Aber ist das unser Traum vom Winter?
Im Januar verursachten Rekordschneehöhen und Schneechaos vor allem bei den Autofahrern Frust und für die Spaziergänger spätestens dann, wenn sie auf eisglattem Untergrund ausrutschen oder bei tauenden Temperaturen durch den „Batz“ gehen müssen. Zudem stieg die Gefahr von Lawinen in den Alpen extrem. Diese wurden unter anderem durch das Befahren gesperrter Skirouten ausgelöst und die herabrutschenden Schneemassen forderten Anfang des Jahres bereits mehrere Menschenopfer. Wie sagte Reinhold Messner in Anbetracht der Unbelehrbaren, der sich und andere in Gefahr bringende Sportler: „Nicht der Mensch bezwingt die Natur, die Natur bezwingt den Menschen.“
Dabei ist die Fortbewegung im Schnee eine der Möglichkeiten sich Landschaft anzueignen, mit der Natur eins zu werden. Um das Winterglück für Langläufer, Rodler, Skifahrer, Snowboarder oder Biathleten zu sichern, kann heutzutage – mit all seinen Einschnitten in die Natur – technisch nachgeholfen werden. Bekanntlich ist Schnee nur eine andere Form des Regens. Im Gegensatz zum Regen besitzt der Schnee jedoch etwas Märchenhaftes: Kindern wird erzählt, dass die Federn von Frau Holles Kopfkissen wie Schneeflocken umherfliegen und für den Winterzauber sorgen. Wenn die hartgesottenen Motorradfahrer Ende Januar bzw. Anfang Februar zum traditionellen Elefantentreffen im Hexenkessel von Loh im Bayerischen Wald zusammenkommen, dann ist die Wetterlage zweitrangig. Denn egal, ob nun Schnee oder Regen: Ihr Winterwochenende ist noch nie ins Wasser gefallen, aber manch einer mit Sicherheit im Schlamm stecken geblieben.
Fakt in diesem Winter ist zweierlei: Während die Räumdienste Anfang des Jahres im Dauereinsatz waren und Feuerwehren, THW und die Bundeswehr Dächer räumten, freuen sich nach wie vor die Wintersportler – sollten die Skilifte ihren Betrieb nicht eingestellt haben wie im Januar kurzzeitig am Arber. Aber auch die Kinder freute es: Die Schule fiel in den Landkreisen Freyung-Grafenau und Regen sowie zum Teil in den Landkreisen Straubing-Bogen, Deggendorf und Passau aus. Für die Schüler gab es Extraferien. Und auf den Gipfeln im Bayerischen Wald konnte ein seltenes Naturschauspiel beobachtet werden: die Arbermandl. Dabei verwandeln sich die verschneiten Latschen und Bergfichten durch Ostwind, Schnee und Kälte in geheimnisvolle Gestalten.
Also nicht verzagen. Letztlich gilt ein Sprichwort, falls wir das Frühjahr aufgrund von Klimaerwärmung überspringen sollten: „Der Schnee zerrinnt, der Mai beginnt.“
CD
Der kreative Mensch
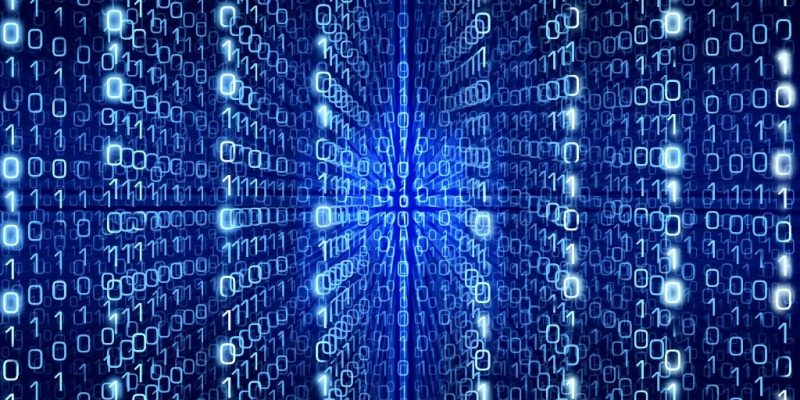
In seiner Jahrtausende andauernden kulturgeschichtlichen Entwicklung hat der Mensch unzählige technische Innovationen hervorgebracht. Das zeigen die vielen archäologischen Funde nicht zuletzt aus Niederbayern, das an Bodendenkmälern reich ist.
Die Entdeckung und kontrollierte Verwendung des Feuers, die Erfindung einfacher Werkzeuge während der Vor- und Frühzeit sowie ihre permanente Fortentwicklung danach waren nicht weniger revolutionär als die Erfindung und Anwendung des Personal Computers seit der Moderne. Letzteres mag für junge Menschen, welche mit Smartphone und Tablet aufwachsen, das Telefon mit Wählscheibe oder die mechanische Schreibmaschine nur mehr aus dem Museum kennen, bereits ewig lange zurückliegen. Doch kultur- und entwicklungsgeschichtlich betrachtet stehen wir erst am Anfang des digitalen Zeitalters mit all seinen Vorteilen und Problemen. Diese Doppelwertigkeit im Sinne von Fluch und Segen scheint vielen Neuerungen quer durch die Geschichte, und noch mehr ihrer Nutzung, innezuwohnen. Denn nicht die Erfindungen per se sind gut oder schlecht. Für deren nutzbringenden oder destruktiven Einsatz entscheiden sich vielmehr die Anwender.
Schon der Steinzeitmensch konnte sich am Feuer wärmen und zugleich damit brandschatzen. Das uralte Messer ist als Werkzeug zur Nahrungszubereitung unentbehrlich, aber ebenso wird es seit seiner Erfindung als Mordwaffe missbraucht. Die Digitalisierung beschert uns heute Kommunikationsmöglichkeiten, von denen wir einst nicht einmal geträumt hätten; gleichzeitig macht sie uns gläsern und angreifbar. Denn wo nicht nur kriminelle Hacker, sondern pubertierende Pennäler problemlos in hochkomplexe Systeme eindringen und Daten ausspionieren können, wird neben den technischen Sicherheitslücken eines offensichtlich: Die Ohnmacht, mit der wir all den möglichen Missbräuchen gegenüberstehen. Weder in seiner positiven noch negativen Energie ist der Mensch berechenbar. Einerseits beweist er sich stets aufs Neue in seiner Genialität, andererseits erweist er sich auch als beständiges Sicherheitsrisiko.
Einem anderen riskanten Phänomen, nämlich der menschlichen Fehleranfälligkeit, die beispielsweise durch Unachtsamkeit, Überforderung oder Fehleinschätzung im Straßenverkehr zu schwerwiegenden Unfällen führt, versucht man seit längerem mit der Entwicklung des autonomen Fahrens entgegenzuwirken. Dass dies irgendwann fehlerfrei funktionieren wird, mag technisch realisierbar sein. Aber es ist idealtypisch gedacht. Es wäre nämlich naiv zu glauben, kriminelle Kreativität würde nicht auch diese Entwicklung korrumpieren und den Traum vom gefahrenlosen automatisierten Fahren zerstören können.
Übrigens, ebenso wie bekannte Autokonzerne hierzulande und anderswo das Rad zur Fortbewegung nicht erfunden haben, wurde autonomes Fahren schon Jahrhunderte vorher in der agrarischen Gesellschaft erfolgreich praktiziert: Pferdegespanne fanden eigenständig ihren Weg nach Hause, wenn ihre betrunkenen oder übermüdeten Lenker auf dem Kutschbock die Zügel schleifen ließen. Mancher stürzte dabei vom Bock und brach sich das Genick. Andere fielen skrupellosen Wegelagerern zum Opfer. Die Gefahren gingen also auch im analogen Zeitalter zumeist vom Menschen selbst aus.
MS
Vergänglich und treu: der Schneemann

„Juchhe, Schnee!“ mag manch einer gejauchzt haben, bevor im eben erst begonnenen Jahr nicht enden wollende Massen der weißen Himmelsgabe Straßen verstopft, Züge lahmgelegt, Dörfer abgeschnitten und den gesamten Alpenraum in ein Katastrophengebiet verwandelt haben. Der Winter zeigt sich heuer von einer düsteren Seite. Mit ein bisschen Phantasie lässt sich auch vom kuscheligen Sofa aus nachvollziehen, dass der Schnee, den heutzutage Wintersportler und Naturromantiker gleichermaßen herbeisehnen, in den Jahrhunderten ohne Elektrifizierung und Zentralheizung ein wahres Schreckgespenst war. Von wegen gute alte Zeit…
So war auch der Schneemann, heute niedliches Dekor auf Kindersocken oder Weihnachtspostkarten und beliebter Disney-Held, in seinen Anfangsjahren ein übler Geselle. Erste Abbildungen auf Kalenderblättern des 18. Jahrhunderts zeigen ihn mit grimmiger Miene, stechendem Blick und bedrohlicher Geste – wahrhaft zum Fürchten, wie die damals harte, oft lebensbedrohliche Winterzeit selbst.
Zum Freund der Kinder und Symbol unbeschwerter Winterfreuden wurde der Schneemann erst im 19. Jahrhundert. Aus der finsteren Gestalt entwickelte sich jener kugelige, gemütliche Geselle mit Rübennase, Kohlen- oder Knopfaugen und Kochtopfhut, der uns in schneereichen Wintern auch heute noch allerorten begegnet. Ganz im Sinne biedermeierlicher Familienvorstellungen gehörte er von da an als positiv besetzte Figur zum festen Repertoire von Winterdarstellungen in Kinder- und Hausbüchern. Befördert wurde seine Beliebtheit durch die populäre Druckgraphik des 19. und 20. Jahrhunderts, die Schneemann-Motive zu Weihnachten und Neujahr in die ganze Welt verbreitete. Kein Wunder, dass auch die Werbeindustrie bald das Potenzial des sympathischen Winterboten entdeckte. Weltanschaulich wie religiös unbesetzt lässt sich der Schneemann schließlich für vielerlei Botschaften einsetzen.
Dass das Internet aktuell eine Vielzahl detailreicher Bauanleitungen für Schneemänner bietet – bezeichnenderweise auf Seiten mit Titeln wie „familienleben“, „vaterfreuden“ oder „heimhelden“ – mag den ein oder anderen passionierten Schneemannbauer kränken. Denn ‚learning by doing‘ lautet die Devise. Es ist schließlich noch kein Schneemann-Baumeister vom Himmel gefallen.
Leider ist die Lebensdauer der weißen Gesellen in der Regel auf wenige kalte Tage und Nächte beschränkt. Wer dennoch nicht genug kriegen kann von Schneemännern, der markiere sich den 18. Januar im Kalender: den Welttag des Schneemanns. Und dann „Mein Kind, nun sag mir an, wer ist ein gemachter Mann?“
CLL